Bis
1945:
Größere Flüsse sind für die umgebende Landschaft eine bedeutende Abgrenzung.
Ein wichtiger Grund für das Entstehen der Stadt Bremen vor über 1.200 Jahren
war eine hier vorhandene Furt, die das Überqueren der Weser zuließ. Seit
1244 gab es im Ort eine Brücke über den Strom. Im 16. Jahrhundert begann
die Besiedlung des linken Ufers. Es blieb allerdings bis ins 19. Jahrhundert
bei einer einzelnen Weserquerung.
1866
konnte eine neue Eisenbahnbrücke für die Strecke von Bremen nach Oldenburg
in Betrieb genommen werden. Daran waren auf beiden Seiten Fußgängerstege
angehängt. Als zweite Straßenbrücke stand ab 1875 die Kaiserbrücke zur
Verfügung, heutiger Name Bürgermeister-Smidt-Brücke. 1939 folgte die
dritte Straßenbrücke. Zu ihrer Bauzeit Westbrücke, und ab Einweihung
Adolf-Hitler-Brücke genannt, stand sie an der Position der heutigen Stephanibrücke.
Zwischen 1939 und 1947 trug die älteste Querung den Namen Lüderitzbrücke,
danach wieder Große Weserbrücke.
Bei Beginn des II. Weltkrieges im Jahr 1939 lebten immerhin rund 420.000
Menschen in Bremen. Es gab aber im Stadtzentrum nur drei Möglichkeiten,
zu Fuß oder mit Fahrzeugen die Weser zu überwinden, zuzüglich der Eisenbahnbrücke.
Dadurch wird deutlich, daß der Ausfall einer Brücke starke Einschränkungen
des Verkehrsflusses nach sich ziehen würde.
Flußabwärts Richtung Nordsee folgen bis heute keine weiteren Brücken.
Flußaufwärts befanden sich an Weser-Kilometer 362 ein Wehr mit Wasserkraftwerk
und Schleuse. Am Weserwehr führte ein Fußweg über den Strom. 5 km weiter
befindet sich seit 1873 eine weitere Eisenbahnbrücke, für die bedeutende
Verbindung vom Ruhrgebiet über Bremen nach Hamburg. Eine Straßenbrücke
folgt erst wieder bei Kilometer 341 in Achim-Uesen. Die Ausweichmöglichkeiten
im Raum Bremen waren also sehr eingeschränkt.
Im übrigen gilt die Problematik auch heute. Es gibt inzwischen mit der
Karl-Carstens-Brücke und der Brücke der Autobahn A1 zwei weitere Querungen,
zuzüglich einer kleinen Fußgängerbrücke im Innenstadtbereich. Die Mehrzahl
ist heute wesentlich breiter und mit mehr Fahrspuren ausgelegt. Allerdings
hat auch der Verkehr sehr stark zugenommen. Bei Blockaden durch Unfälle
oder Reparaturarbeiten, gibt es regelmäßig große Staus, die sich über
weitere Teile des Stadtgebietes ausdehnen. In den letzten Jahren zeigen
die Brücken, nach langer Nutzungszeit mit beständig ansteigenden Lasten,
statische Probleme. Teilweise ist ein Neubau erforderlich; das Thema
wird in Zukunft noch viele Belastungen für Verkehr und Anwohner bringen.
Im II. Weltkrieg waren die bremischen Brücken von strategischer
Bedeutung, wie auch andernorts alle weiteren bedeutenderen Flußquerungen.
Seinerzeit trug die Eisenbahn die Hauptlast des Transports von Menschen
und Gütern. Demensprechend versuchten die Alliierten, diese Verbindungen
zu stören. Es sind zum Ende des Krieges sehr viele Bomben auf die Brücken
geworfen worden. Ein solch schmales Bauwerk ist nicht einfach zu treffen,
die meisten schlugen im Umfeld ein. Es gab aber auch diverse Nah- und
Volltreffer, die zu Beschädigungen oder Unterbrechungen führten.
Zum Ende der Kampfhandlungen im Frühjahr 1945 drehte sich das Blatt.
Es war nun der Zeitpunkt erreicht, an dem deutsches Militär die verbliebenen
Brücken sprengen sollte, damit der Gegner in seinem Vormarsch gebremst
wird. Die Weserbrücken hatten also kaum eine Chance, den Krieg zu überstehen.
Um bei einer Unterbrechung der Straßenbrücken zwischen Altstadt
und Neustadt eine alternative Verbindung zu ermöglichen, wurde von deutscher
Seite vermutlich Ende 1944 eine optionale Fährverbindung vorbereitet.
Bei der Altmannshöhe ist aus Trümmerschutt eine Rampe vom Osterdeich
im Bogen herab zur Weser angeschüttet worden. Auf der südlichen Uferseite
entstand eine gerade Verbindung zur Werderstraße.
Heute erscheint eine solche Querung unvollständig, da weiterhin Richtung
Süden die Kleine Weser und der Werdersee größere Gewässerhindernisse
bilden. Aber die heutige „Insellage“ ist seinerzeit nicht gegeben gewesen.
Die Kleine Weser reichte nur bis zum Deichschart, und den Werdersee gab
es noch nicht. Somit hätte der Verkehr Richtung Süden über mehrere Straßen
weiter abfließen können.
Es war geplant, im Bedarfsfall die Fahrzeugfähre von der rund 55 km flußabwärts
betriebenen Verbindung Kleinensiel - Dedesdorf auf dem Wasserweg nach
Bremen zu überführen. Es blieben jedoch bis zum Kriegsende örtliche Straßenbrücken
benutzbar, für die Heranführung der Fähre ergab sich kein Bedarf.
Über die Kriegsjahre gab es zahlreiche Angriffe von britischen
und amerikanischen Bomberverbänden auf die Stadt Bremen. Trotz großflächiger
Zerstörungen blieben die Brücken bis ins letzte Kriegsjahr erstaunlicherweise
weitgehend unbeschädigt. Am 24. Februar 1945 erfolgte eine gezielte Bombardierung
der Innenstadt und der Verkehrsanlagen. Dabei erlitt die Lüderitzbrücke
gravierende Schäden, sie mußte zunächst für den Verkehr gesperrt werden.
Doch bereits am folgenden Tag gab die Polizei den Verkehr eigenmächtig
wieder frei, da sich erhebliche Schwierigkeiten im innerstädtischen Verkehrsfluß
ergeben hatten. Dabei hatten Statiker erst begonnen, die Tragfähigkeit
zu untersuchen.
Ein weiterer Angriff auf die Brücken wurde am 23. März geflogen. In diesem
Fall kam es zur Zerstörung der Eisenbahnbrücke. Als Folge ist die Verlegung
der Eisenbahnstrecke auf die bis dahin noch weitgehend intakte Adolf-Hitler-Brücke
begonnen worden. Dazu mußte man diese Weserquerung dem Straßenverkehr
entziehen. Darüber berichtet die Seite Bremen
1945: Die Eisenbahn-Strecken.
So blieben bis zum Ende des Krieges die Lüderitzbrücke und
die Kaiserbrücke benutzbar. Im April 1945 hatten sich britische Verbände
bereits bis in die Außenbezirke der Stadt Bremen vorgekämpft. Am 4. des
Monats sprengten deutsche Verbände die Straßenbrücke in Achim-Uesen.
Am 10. schlugen erste Artillerie-Granaten an der Lüderitzbrücke ein.
Am 17. April konnten die Briten bei Verden die Weser überwinden. Sie
begannen am Folgetag ihren Vormarsch auf dem rechten Weserufer Richtung
Bremen. Somit verloren die bremischen Weserbrücken ihre strategische
Bedeutung für das Aufhalten des Gegners weitgehend. Dennoch wollte die
Wehrmachtsführung sie unbedingt zerstören. Dazu kam es am 25. April.
An dem Tag wurden die Lüderitzbrücke und die Kaiserbrücke gesprengt.
Auch die beschädigte und für den Schienenverkehr bereits nicht mehr benutzbare
Eisenbahnbrücke bei Dreye ist an dem Tag endgültig zerstört worden. Somit
gab es in Bremen nun keine für den Verkehr nutzbaren Weserquerungen mehr. Lediglich
der Fußweg am Weserwehr in Hastedt konnte noch passiert werden.
Die
bremischen Straßenbrücken zwischen Altstadt und Neustadt.
1: Westbrücke, bzw. ab Einweihung
1939 Adolf-Hitler-Brücke. Heute ersetzt durch Stephanibrücke.
2: Kaiserbrücke, heute ersetzt
durch Bürgermeister-Smidt-Brücke.
3: Große Weserbrücke, bzw.
1934-39 Adolf-Hitler-Brücke und 1939-47 Lüderitzbrücke. Heute ersetzt
durch Wilhelm-Kaisen-Brücke.
Violett: Die
vorbereitete Fährstelle für den Straßenverkehr zwischen Bremen-Altstadt
und Bremen-Neustadt.
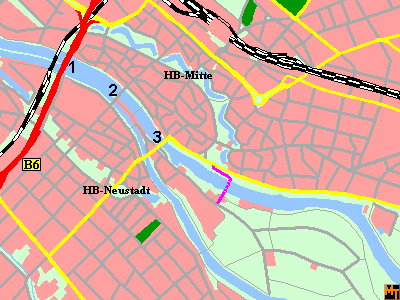

Zum Kriegsende eroberten die Briten Bremen in mehrtägigen
Kämpfen. Am 27. April 1945 kapitulierte der Kampfkommandant der Stadt.
Den Truppen der Alliierten fehlten nun natürlich die Flußbrücken; es
mußten große Massen an Verbänden und Nachschub für den weiteren Vormarsch
über die Weser gebracht werden. Da die Kampfhandlungen geendet hatten,
konnte man nun aber sofort ungefährdet Kriegsbrücken durch Pioniere bauen.
Bereits am nächsten Tag begannen Einheiten der Royal Engineers mit dem
Aufbau einer Behelfsbrücke mittels Bailey-Brückengerät. Als geeignetste
Position ist die vorbereitete Fährstelle zwischen Osterdeich und Werderstraße
ausersehen worden. Somit hatte die deutsche Seite gewissermaßen die Vorarbeiten
für eine Brücke ihres Kriegsgegners ausgeführt!
Das Brückengerät schwamm auf drei großen Schuten im Fluß. Darauf befand
sich die eigentliche, auf beiden Ufern befestigte Brücke. Sie bestand
aus einem zusammengesetzten Stahlfachwerk, die Fahrbahn wurde mit dicken
Holzbalken ausgelegt. Die Tragfähigkeit belief sich auf 40 t. Zwischen
Brücke und Wasser wies die Durchfahrthöhe nur 3,1 m auf. Schiffsverkehr
war somit natürlich nicht mehr möglich. Ab 2. Mai rollte der ausschließlich
militärische Verkehr darüber.
Ergänzend ist an der Position der Sielwallfähre eine kleine Schwimmbrücke
gebaut worden. Entweder vom Typ „Folding Boat Equipment“ oder „Kapok
Infantry Assault Bridge“. Diese führte mit zahlreichen Pontons über den
Fluß, und konnte nur zu Fuß oder bestenfalls mit leichten Fahrzeugen
überquert werden. Sie entstand etwa um den 12. Mai und wurde bereits
um den 7. Juli wieder abgebaut.
Ab
1945:
Wie oben beschrieben, hatte das deutsche Militär am 25. April 1945 die
letzten zwei Brücken in der Stadt Bremen gesprengt. Die gegnerischen
Truppen konnten dadurch nicht aufgehalten werden. Leidtragende der Zerstörungen
sind nun die Einwohner der Hansestadt. Die Weserbrücken trugen zuvor
auch Versorgungsleitungen für Gas und Strom, die jetzt unterbrochen waren.
Das größte Gaswerk der Stadt befand sich in Woltmershausen, links der
Weser. Die rechte Weserseite ist somit davon komplett abgeschnitten gewesen.
Die einzige begehbare erhaltene Verbindung war der Fußweg am Wasserkraftwerk
in Hastedt. Außerdem wurde die innerstädtische Eisenbahnbrücke mit einer
teils waghalsigen Konstruktion für Fußgänger passierbar gemacht. Man
legte Holzbohlen zwischen verbliebene Brückenteile.
Am 20. Mai 1945 übernahmen vereinbarungsgemäß die USA das
Gebiet als abgesetzten Teil ihrer Besatzungszone, die „Bremen Enclave”.
Die bremische Stadtverwaltung hatte naturgemäß großes Interesse, die
Weserquerungen wieder herzustellen. Die US-Truppen hielten sich bei der
Unterstützung zunächst zurück. Größtes Problem ist der Mangel an Material
gewesen. Alles Erforderliche sollte im Stadtgebiet gefunden werden. Versuche,
aus dem niedersächsischen Umland oder aus Hamburg Material zu erhalten,
scheiterten. Aus der britischen Zone durfte man nichts nach Bremen abgeben.
Den Alliierten war zunächst die Wiederherstellung der beiden
Eisenbahnbrücken wichtig. Die Arbeiten begannen an der Dreyer Brücke.
Die Siegermächte setzten dazu kriegsgefangene deutsche Pioniere ein.
Benötigtes Material, insbesondere Ersatzbrücken, führte man aus dem Bestand
der Reichsbahn relativ problemlos und zügig heran. Bereits ab Mitte August
1945 konnte die Brücke eingleisig wieder befahren werden.
An der innerstädtischen Eisenbahnbrücke gab es noch ein Kuriosum. Weiterhin
führte dort ein Bohlenweg über die Reste, der intensiv von Fußgängern
genutzt wurde. Da der Pfad schmal war, konnte man ihn nur in eine Richtung
passieren. Vor Ort regelte die Polizei den Einweg-Verkehr, längere Wartezeiten
mußten in Kauf genommen werden. Mitte des Jahres 1945 rutschte ein größeres
Brückenteil in die Weser ab, damit entfiel die Nutzbarkeit dieser Querung.
Mittlerweile hatten Pioniere der US Army eine Behelfsbrücke
neben der Lüderitzbrücke begonnen. Am 15. Juni 1945 erfolgte ihre Eröffnung.
Auch der Zivilverkehr durfte das Bauwerk nutzen, nun Memorial-Bridge
genannt. Zu der Zeit ist die schwimmende Bailey-Brücke bei der Altmannshöhe
ebenfalls für Zivilisten freigegeben worden.
Ab August begannen an der hiesigen Eisenbahnbrücke Aufräumarbeiten für
den Wiederaufbau. Die im Fluß liegenden Brückenreste behinderten die
Schiffahrt und mußten beseitigt werden. Zur Wiederherstellung des Schienenweges
ersetzte man fehlende Brückenelemente mit Roth-Waagner-Gerät. Die Bauarbeiten
waren hier in der Weser ungleich schwieriger, als in Dreye. Daher konnte
die Eröffnung für einen eingleisigen Betrieb erst am 9. Dezember des
folgenden Jahres stattfinden.
Ende November 1945 begann das US-Militär den Bau einer zweiten Behelfsbrücke.
Sie entstand an einer zentralen Position. Die Trasse ist durch die heutige
Bebauung kaum noch vorstellbar ist. Der Straßenzug führte von Kurze Wallfahrt
über Ansgaritränkpforte zur Weser, dort über den Teerhof und die Kleine
Weser zur Neustadt-Seite in die Häschenstraße. Sie bekam nach Fertigstellung
den Namen Trumanbrücke.
Bereits im Winter 1945/46 zeigten sich für die provisorischen
Brücken Probleme durch stärkeren Eisgang auf der Weser. Die Bailey-Brücke
an der Altmannshöhe mußte Ende Januar 1946 sicherheitshalber eingeholt
werden.
Zum Schlimmsten kam es gut ein Jahr später. Der Winter 1946/47 wurde
durch besondere Kälte und Länge zu einem der strengsten im 20. Jahrhundert.
Die Weser fror zu, ein Umstand der ansonsten sehr selten eintritt. Mit
wieder steigenden Temperaturen wuchs die Menge des Richtung Nordsee strömenden
Wassers enorm an. Die Fließgeschwindigkeit betrug etwa 5 m/sek.
Am 17. März konnten die ersten Brücken dem Druck nicht mehr standhalten.
Zuerst brach die Memorial-Brücke ein, Stunden später traf es die Trumanbrücke.
Am frühen Abend rissen sich bei Achim-Baden, im begonnenen Schleusenkanal
Langwedel zwei Schiffe und ein Ponton los. Ein Schiff konnte abgefangen
und gesichert werden, die anderen trieben nun auf Bremen zu. Die Dreyer
Eisenbahnbrücke passierten sie, ohne Schäden anzurichten. Am Weserwehr
in Hastedt reißt das Schiff die Fußgängerbrücke ein. An der dortigen
Schleuse rissen sich weitere zwölf Wasserfahrzeuge los. Auf Bitten der
bremischen Verwaltung beschießt die US Army die Schiffe mit leichten
Geschützen, vermutlich Panzerabwehrkanonen M3 mit Kaliber 37 mm, um sie
zu versenken. Es gab zwar mehrere Treffer, die entstandenen Löcher waren
jedoch zu klein, die Boote schnell vollaufen zu lassen. Da zwischen den
treibenden Wasserfahrzeugen ein Schlepper die Sicherung
einzelner Boote versuchte, mußte der Beschuß schnell wieder eingestellt
werden, um die Besatzung nicht zu gefährden. Beim Polizeihaus am Wall
stand ein Panzer mit größerem Geschütz bereit, kam aber in Folge dessen
nicht mehr zum Einsatz. Gegen 19:00 Uhr treffen die Schwimmkörper auf
die Baustelle zur Wiederherstellung der Kaiserbrücke, und zerstören alle
bisherigen Baumaßnahmen. Kurz nach 20:00 Uhr wird auch das Roth-Waagner-Gerät
von der Eisenbahnbrücke herabgerissen. So sind am Ende des Tages wieder
alle Weserquerungen im bremischen Stadtgebiet zerstört. Das Ereignis
wurde bekannt als die Bremer Eiskatastrophe 1947.
Die Verbindungen in der Stadt mußten nun Fähren und Boote
übernehmen. Der Fahrzeugverkehr ist auf die größeren Fähren an der Unterweser
verwiesen worden. Die nächstgelegene war die Verbindung Vegesack - Lemwerder,
rund 17 km flußabwärts.
Ab 21. März 1947 baute man einen Laufsteg über die Lücke der Lüderitzbrücke.
Bereits drei Tage später konnte er genutzt werden. Aufgrund des zu erwartenden
großen Andrangs hat die Stadtverwaltung die Ausstellung von Passierscheinen
für Personen mit besonderen Anliegen verfügt.
Wieder wurden US-Pioniere aktiv, um eine neue Bailey-Brücke zu errichten.
Diese hat man aufgrund der günstigsten Voraussetzungen auf der Eisenbahnbrücke
verlegt. Ab 25. März konnte sie zu eingeschränkten Zeiten von Fußgängern
passiert werden. Drei Tage später war der Bau soweit vollständig, daß
nun auch Fahrzeuge darüber fahren konnten. Zur gleichen Zeit begann die
Wiederherstellung für die Eisenbahn. Die bisherigen Brückenelemente sind
bei der Katastrophe am 18. März heruntergeschoben worden. Die Brückenpfeiler
hatten dabei keine größeren Schäden davon getragen. So konnten neue Roth-Waagner-Elemente
herangeschafft und montiert werden. Auf der bis 1945 zweigleisigen Brücke
lagen nun auf einer Gleistrasse die Notbrücke für Personen- und Fahrzeugverkehr
und auf der anderen Trasse Schienen. Bereits am 26. April konnte der
erste Zug die Brücke befahren.
Ab Anfang April arbeitete man an der Wiederherstellung der Memorial-Brücke,
ebenfalls unter Verwendung von Bailey-Gerät. Am 8. Mai konnte sie für
den Verkehr freigegeben werden. Für alle Verantwortlichen erkennbar war
die Wichtigkeit, rechtzeitig vor dem nächsten Winter eine dauerhafte
Weserquerung wieder herzustellen. Dazu konzentrierte man nun alle Aktivitäten
auf den Wiederaufbau der Lüderitzbrücke, in weitgehend ursprünglicher
Form. Dort ist schon vor der Eiskatastrophe gearbeitet worden. Am 18.
März hatten sich an diesem Bau keine größeren Schäden ergeben, sodaß
hier nun mit Hochdruck weiter gearbeitet werden konnte. Es wurde rechtzeitig
geschafft, die Brücke hat man am 29. November 1947 feierlich eingeweiht.
Die erste dauerhafte Brücke im Stadtgebiet seit dem 25. April 1945 stand
nun für den Verkehr, einschließlich Straßenbahnstrecke, wieder zur Verfügung.
Bald danach erfolgte der Abbau der benachbarten
Memorial-Brücke, dieses zog sich noch über die Wintermonate hin.
Die Stadtverwaltung hat inzwischen entschieden, die Trumanbrücke nicht
wieder aufzubauen. Auch auf die Kaiserbrücke wurde vorerst verzichtet,
die Zerstörungen an deren Baustelle waren zu gravierend. So sollte als
nächstes die bisherige Adolf-Hitler-Brücke aufgebaut werden, inzwischen
Westbrücke genannt. Dazu verwendete man wieder Ersatzbrückengerät, diesmal
vom Typ Schaper-Krupp-Reichsbahn (SKR-6). Im Juli 1947 traf das Gerät
in Bremen ein, die Montage folgte umgehend. Die neue Querung konnte am
31. Dezember 1947 dem Verkehr übergeben werden. Gleichzeitig bekam sie
den Namen Stephanibrücke. Anfang 1948 folgte der Abbau der vom Straßenverkehr
genutzten Behelfsfahrbahn auf der Eisenbahnbrücke.
Als letzte Wiederherstellung alter Querungen konnte im Oktober 1948 in
Hastedt die Wehrbrücke eröffnet werden. Hier mußte man zuvor das Weserwehr
weitgehend neu aufbauen, da die Eiskatastrophe sehr große Schäden verursacht
hatte.
Schon wenige Jahre später ergab sich, daß die in früheren
Jahrzehnten konzipierten Brücken den nun deutlich ansteigenden Verkehr
nicht mehr bewältigen konnten. So plante man, alle Brücken durch komplett
neue Bauwerke mit deutlich größerer Kapazität zu ersetzen.
Am 28. Juni 1952 konnte an Stelle der früheren Kaiserbrücke die wesentlich
größere Bürgermeister-Smidt-Brücke eingeweiht werden. Die neue Große
Weserbrücke bekam eine andere Trassierung. Während die alte Konstruktion
auf der Altstadt-Seite geradeaus in die Wachtstraße und weiter zum Marktplatz
führte, war die Anbindung der neuen Brücke auf die Balgebrückstraße ausgerichtet.
Sie ist am 22. Dezember 1960 eröffnet worden. 1960/61 hat die Deutsche
Bundesbahn die komplette Erneuerung der Eisenbahnbrücke durchgeführt.
Anfang der 1960er Jahre wurde am Südrand der Stadt die Autobahn A1 Richtung
Osnabrück weitergebaut. Sie bekam eine Weserquerung bei Flußkilometer
358. 1963 erfolgte die Verkehrsfreigabe. Auch die bislang mit dem SKR-Ersatzbrückengerät
ausgestattete Stephanibrücke mußte erneuert werden. Im Herbst 1967 folgte
deren Eröffnung. Als vorerst letzte Straßenbrücke hat man am 25. September
1971 die Karl-Carstens-Brücke
eingeweiht. Sie verbindet bei Flußkilometer 363 die Ortsteile Hastedt
und Habenhausen.
Abschließend sei erwähnt, daß sich die strategische Bedeutung
der Brücken auch nach dem II. Weltkrieg nicht geändert hat. Im Kalten
Krieg befanden sich an den Bauwerken Vorbereitungen, um sie im Fall des
Vormarsches von Truppen des Warschauer Paktes sprengen zu können. Es
wurden die geeignetsten Stellen ermittelt und dort beispielsweise Befestigungen
für Schneidladungen angebracht.
Zustand:
Wie oben beschrieben, wurden alle innerstädtischen Brücken im Laufe der
Jahrzehnte erneuert. Somit sind dort keine historischen Spuren aufzufinden.
Zugang:
Von den hier vorgestellten Objekten sind zumindest die Örtlichkeiten einsehbar. |
Fotos:
Die Weserbrücken:

Die heutige Wilhelm-Kaisen-Brücke ersetzte 1960 die alte Große Weserbrücke
bzw. Lüderitzbrücke.

Ungefähr auf der gleichen Trasse stand ab Juni 1945 als Behelfsbrücke
die von US-Pionieren errichtete Memorial-Bridge.

Früher führte die Wachtstraße geradeaus auf die alte Große Weserbrücke.
Heute steht ein Bürogebäude auf der Trasse.

Das Bürogebäude von der Flußseite. In der Bildmitte begann die Brücke
auf der Altstadt-Seite.

Orientierung über den Brücken-Standort auf der Neustadt-Seite bietet
das Schild unten mit der Ziffer 0. Hier beginnt die Kilometrierung
der Unterweser, seinerzeit genau an der früheren Großen Weserbrücke.

Am Flußufer stehen Löwenköpfe der alten Brückenportale. Sie sind bei
der Sprengung 1945 in die Weser gefallen und 1998 bei Baggerarbeiten
wiedergefunden worden.

Heute kaum noch vorstellbar, die Auffahrt zur Trumanbrücke führte hier
1945-1947 durch die Ansgaritränkpforte zur Weser.

Auf der Neustadt-Seite war das Gegenstück an dieser Stelle in der Häschenstraße.
Seinerzeit standen auf beiden Seiten der Weser allerdings überwiegend
Ruinen.

Seit 1952 ersetzt die neugebaute Bürgermeister-Smidt-Brücke die frühere
Kaiserbrücke.

Die 1967 eröffnete komplett neugebaute Stephanibrücke ersetze die frühere
Adolf-Hitler-Brücke bzw. alte Stephanibrücke.

In Blickrichtung lag bis 1993 der Fußweg des alten Weserwehrs in Hastedt
über den Strom.

Das heutige Wehr steht fast 200 m weiter flußabwärts.
Die Fährstelle
bzw. Ersatzbrücke für den Straßenverkehr:

An dieser Stelle führte ab 1944 vom Osterdeich nach rechts eine Rampe
herab.

In der Bildmitte schwenkte die Rampe 90° nach rechts zur Weser.

In Blickrichtung wurde ab 28. März 1945 von britischen Pionieren eine
Behelfsbrücke über den Fluß gebaut.

Die Konstruktion schwamm auf drei großen Schuten und war an den Ufern
fest verankert.

Blick von der Neustadt-Seite. Die Querung ist bereits vorher von den
Deutschen als Fährstelle vorbereitet worden.

Auf dem linken Flußufer war keine Rampe erforderlich.

Die Trasse von der Werderstraße zum Fluß ist heute durch Bebauung nicht
mehr erkennbar.
Behelfsbrücken-Gerät:

Zur Anschauung hier eine kleine Ausführung des Bailey-Brückengerätes
auf einen Sockel. Größere Konstruktionen sind in Bremen an mehreren
Stellen als Ersatzbrücken gebaut worden.

Das THW nutzt die Brücke weiterhin. Hier ein Lagerplatz in der THW-Bundesschule
Hoya.

Bei einer Vorführung wird die Montage der Brückenelemente gezeigt.
|